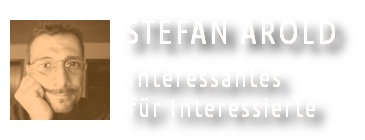Die Länderbahnzeit (1835 - 1919)
Als am 7. Dezember 1835 der erste Zug mit der Lokomotive "Adler" von Nürnberg nach Fürth dampfte, ahnte noch niemand mit welcher rasanten Entwicklung sich dieses Fortbewegungsmittel in Deutschland ausbreiten und welche revolutionären Auswirkungen es auf Industrie, Wirtschaft, Bevölkerung und das Staatswesen insgesamt ausüben würde. Kritische Stimmen warnten davor, dass die hohe Reisegeschwindigkeit (30 km/h) zu Ohnmachtsanfällen führen könne. Die rauchenden Ungetüme von Dampflokomotiven mache das Vieh auf den Feldern scheu. Trotz aller Unkenrufe konnten sich die modernen Kräfte mit ihren Vorstellungen beim Bau der Bahn durchsetzen. Die Initiative für dieses innovative Beförderungsmittel ging dabei weniger vom staatlichen Souverän als vom zahlungskräftigen Bürgertum aus. Um genügend Kapital für das kostspielige und nicht risikoarme Unternehmen aufzubringen wurden Aktiengesellschaften gegründet. Das Material und Know how musste in den Anfangsjahren noch nach Deutschland importiert werden. Der "Adler" sowie der dazugehörige Lokomotivführer James Wilson waren Importe aus dem Mutterland des Eisenbahnbaus, aus England. Dort war man mit der industriellen Entwicklung schon weiter vorangeschritten und auch die Eisenbahn hatte sich bereits als Transportmittel etabliert Der Transport der ersten Lokomotive nach Deutschland gestaltete sich langwierig und dauerte knapp ein halbes Jahr. Er erfolgte auf dem Wasser- und dem Landweg in ein Dutzend Kisten. Sogar die ersten gusseisernen Schienen mussten aus England eingeführt werden, da die deutschen Werke noch nicht über die Leistungsfähigkeit verfügten, die entsprechende Menge des erforderlichen Schienenmaterials selbst herstellen zu können. Übrigens übernahm man von der Insel auch die so genannte Normalspurbreite mit 1435 mm zwischen den beiden Schienen. Erst nach und nach bildete sich die für das Eisenbahnwesen benötigte Schwerindustrie im eigenen Lande aus. Bereits 1838 wurde mit der "Saxonia" die erste deutsche Dampflokomotive gebaut. Die Lok war vollkommen funktionstüchtig, dennoch misstrauten die Verantwortlichen ihrem Konstrukteur und der Lok selbst, so dass man das englische Material noch der eigenen Schaffenskraft vorzog. Übrigens blieb die Grundkonstruktion der Dampflok bis in die Endphase so gut wie unverändert und folgte dem Stephenson'schen Prinzip (Stehkessel mit Feuerbuchse, Langkessel, mit Rauch- und Überhitzerrohren sowie der Rauchkammer).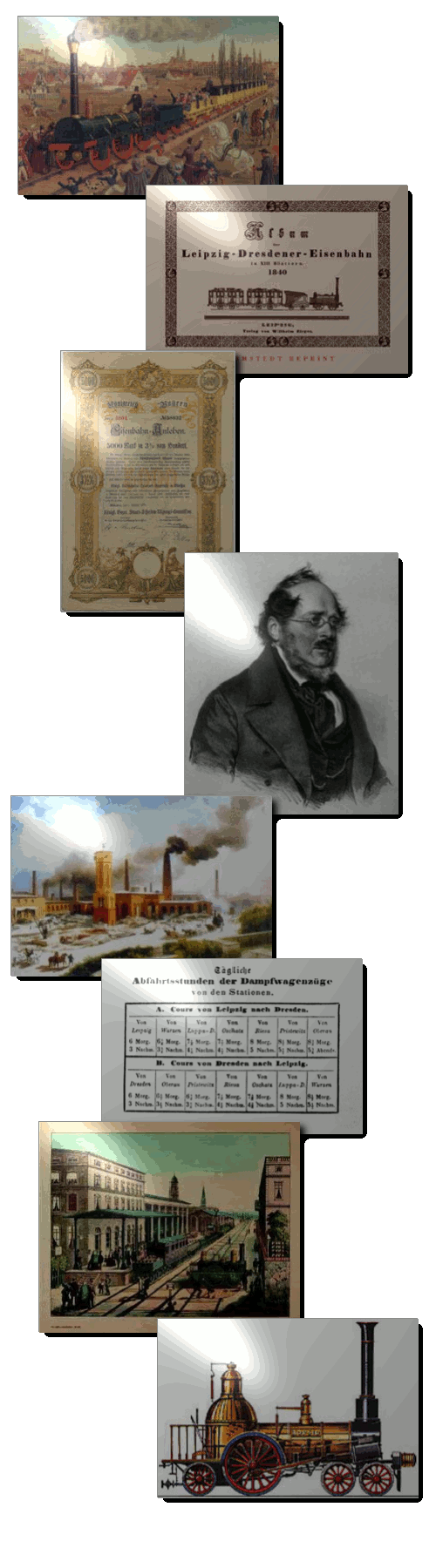 Aus
den
ersten fünf Schienenkilometern des Jahres 1835 entwickelte sich
innerhalb von
nur 35 Jahren eine komplettes, das gesamte deutsche Territorium
umfassende Schienennetz. Weitsichtige
Ökonomen wie z.B. Friedrich List erkannten bereits früh die Bedeutung
des Schienenverkehrs zur Beseitigung der deutschen Kleinstaaterei des
19. Jahrhunderts, grenzüberschreitender Verkehr und damit verbundene
fallende Zollschranken sollten auf wirtschaftlichem Wege zu einer
Einigung aller deutschen Fürsten- und Königshäuser führen. Die Gründung
des Deutschen Zollvereins im Jahr 1834 stellte hierzu bereits den
ersten Schritt dar. Aber der Weg
dorthin war steinig. Zunächst galt es, Eisenbahnen über einen lokalen
Bereich hinaus zu bauen. Die erste Fernverkehrsstrecke verband 1839 die
beiden sächsischen Städte Leipzig und Dresden
miteinander. Das Streckenprofil erforderte bereits etliche Kunstbauten,
wie Brücken und Tunnels, die das Können der damaligen Ingenieure stark
forderte. Nach nur drei Jahren Bauzeit (ohne größere
technische und industrielle Hilfsmittel) konnte die Strecke 1839 ihrer
Bestimmung übergeben werden. Was der Bahnbau in Deutschland
bewirkte, ist vor allem dann
begreifbar, wenn man sich vor Augen führt, dass z.B. mit der Eröffnung
der ersten
Eisenbahn von Kiel nach Altona (damals noch zu Schleswig und Holstein
gehörig) im Jahr 1844 die Reisezeit von ehemals 43 Stunden mit der
Kutsche auf rund drei Stunden sank.
Aus
den
ersten fünf Schienenkilometern des Jahres 1835 entwickelte sich
innerhalb von
nur 35 Jahren eine komplettes, das gesamte deutsche Territorium
umfassende Schienennetz. Weitsichtige
Ökonomen wie z.B. Friedrich List erkannten bereits früh die Bedeutung
des Schienenverkehrs zur Beseitigung der deutschen Kleinstaaterei des
19. Jahrhunderts, grenzüberschreitender Verkehr und damit verbundene
fallende Zollschranken sollten auf wirtschaftlichem Wege zu einer
Einigung aller deutschen Fürsten- und Königshäuser führen. Die Gründung
des Deutschen Zollvereins im Jahr 1834 stellte hierzu bereits den
ersten Schritt dar. Aber der Weg
dorthin war steinig. Zunächst galt es, Eisenbahnen über einen lokalen
Bereich hinaus zu bauen. Die erste Fernverkehrsstrecke verband 1839 die
beiden sächsischen Städte Leipzig und Dresden
miteinander. Das Streckenprofil erforderte bereits etliche Kunstbauten,
wie Brücken und Tunnels, die das Können der damaligen Ingenieure stark
forderte. Nach nur drei Jahren Bauzeit (ohne größere
technische und industrielle Hilfsmittel) konnte die Strecke 1839 ihrer
Bestimmung übergeben werden. Was der Bahnbau in Deutschland
bewirkte, ist vor allem dann
begreifbar, wenn man sich vor Augen führt, dass z.B. mit der Eröffnung
der ersten
Eisenbahn von Kiel nach Altona (damals noch zu Schleswig und Holstein
gehörig) im Jahr 1844 die Reisezeit von ehemals 43 Stunden mit der
Kutsche auf rund drei Stunden sank.Zunehmend erkannten nun auch die Herrscher der einzelnen deutschen Staatsterritorien die Bedeutung des Eisenbahnwesens und brachten sich jetzt stärker bei der Finanzierung der Projekte mit ein. Diese wurden im Laufe der Zeit immer kostspieliger und überstiegen zudem die Möglichkeiten der privaten Investoren. In den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts waren bereits das sächsische Königreich mit dem Bayerischen verbunden. Jetzt bestand eine Verbindung vom Bodensee bis nach Dresden. Hierbei sind vor allem die herausragenden Kunstbauen wie z.B. die Göltzschtalbrücke zu erwähnen. Sie ist nach wie vor die größte Ziegelbrücke der Welt. Bei einer Gesamtlänge von 574 Metern und einer lichten Höhe von 78 Metern wurden mehr als 26 Mio. Ziegel verbaut. Das beeindruckendste ist nach wie vor die Bauzeit nach nur fünf Jahren wurde die Brücke 1851 ohne den Einsatz größerer technischer Hilfsmittel fertiggestellt. Die Gesamtkosten beliefen sich auf ca. 2,2 Mio Taler.
Bis 1860 waren schon mehr als 11.633 km Schienen auf deutschem Boden verlegt, zehn Jahre später immerhin 19.575 km. Im Jahre 1880 verfügte das Deutsche Reich über ein Schienennetz mit 33.838 km und bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs hatte sich das Gesamtnetz inklusive der Lokal- und Nebenbahnen auf stattliche 65.000 km ausgeweitet. Damit hatte es seine größte Ausweitung und zugleich seinen Höhepunkt erreicht.
Mit dem Bau der Eisenbahn entwickelte sich auch die dazugehörige Industrie im eigenen Lande. Lokomotivfabriken schossen in den Deutschland aus dem Boden. Wohlbekannte Namen wie Johann August Borsig mit seiner Maschinenfabrik in Berlin-Tegel, die Herren Krauss und J.A. Maffai in München, Maschinenfabrik Esslingen, Louis Schwartzkopff oder die Hartmannsche Fabrik in Chemnitz, die Firma Henschel in Kassel sowie der Wagon- und Eisenbau der Familie Cramer-Klett bzw. MAN sind hierfür Ausdruck der aufstrebenden deutschen Schwerindustrie. Die Entwicklung des Maschinenbaus machte große Fortschritte. Im Jahr 1879 stellte Werner Siemens auf der Berliner Gewerbeausstellung die erste elektrische Lokomotive der staunenden Welt vor. Der Lokomotivbau gewann im wahrsten Sinne des Wortes an Fahrt. Die Transportzahlen und der wirtschaftliche Aufschwung sprachen für sich. Bis zu den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts herrschte in Deutschland der so genannte Gründerzeit-Boom. Der Name Levi Strousberg, als deutscher Eisenbahnkönig ist eng mit dieser Zeit verbunden.
Das Transportwesen beflügelte nicht nur die Wirtschaft, sondern sorgte auch dafür, dass Deutschland aus dem agrarischen Staatswesen heraus und in das industrielle Zeitalter eintrat, gleichwohl auch mit allen Problemen, die hiermit verbunden waren. So wuchsen die Städte in kurzer Zeit enorm. Ungelerntes Personal bildete eine proletarische Unterschicht, die in schlecht belüfteten und belichteten Mietskasernen untergebracht war. Es gab noch kaum eine soziale Absicherung. Das Kranken- und Sozialversicherungswesen steckte noch in den Kinderschuhen und sollte sich erst zum Ende des Jahrhunderts ausbilden. Dafür gewährleistete der Bahnbau auch ungelernten Kräften Beschäftigungs- und Einkommensmöglichkeiten. Die Arbeit war schwer und nicht ungefährlich. Die enormen Erdbewegungen, die zur Trassierung der Strecken bewegt werden mussten, erforderten unzählige Arbeitskräfte. Anderenfalls wäre die enorme Leistung des Eisenbahnbaus nicht bewerkstelligt worden. Die Eisenbahn benötigte zudem immer mehr Personal, Lokführer, Heizer, Schaffner, Bahnhofs-, Rangier- und Stellwerkspersonal, Schrankenwärter und Streckenläufer.
Da das Verkehrsmittel Eisenbahn immer stärker frequentiert wurde, musste auch die Sicherheit der beförderten Personen und Güter nachhaltig verbessert werden. Die ersten auf Räder und auf Schienen gestellten Kutschkamisen wichen schon bald gut ausgestatteten Wagons. Auch in der Dritten Klasse musste bald niemand mehr im ungedeckten Wagen fahren, das vor allem bei schlechter Witterung eine Zumutung war. Die Erfindung der durchgängigen Druckluftbremse bedeutete ebenfalls einen Gewinn an Sicherheit. Das Signalwesen entwickelte sich beständig und auch der Bau des Schienennetzes verlangte aufgrund der steigenden Belastung einer immer weitergehenden Entwicklung. Darüber hinaus erhöhte sich die Geschwindigkeit der Züge erheblich. Fuhr die erste Dampflok noch mit einer Höchstgeschwindigkeit von 35 km/h, was damals bereits als atemberaubend galt, durchbrach man auf Versuchsfahrten mit Drehstromtriebwagen im Jahre 1903 bereits die Marke von 210 km/h. Schnellzug-Dampflokomotiven mit einer Höchstgeschwindigkeit von 120 bis 140 km/h waren zu dieser Zeit bereits keine Seltenheit mehr.
Auch das Militär erkannte die Bedeutung des neuen Transportmittels für seine Zwecke. Truppenaufmärsche ließen sich mit der Eisenbahn in großer Anzahl und mit dem nötigen zeitlichen Gewinn organisieren. Es war deshalb nicht verwunderlich, dass Preußen seine militärischen Auseinandersetzungen vor allem deswegen gewann, weil es konsequent die Truppenverlagerungen mittels der Eisenbahn und einer ausgefeilten Logistik vollzog. Dies wiederum führte auch dazu, dass der Deutsch-Französische Krieg der Jahre 1870/71 zu Gunsten Deutschlands ausging. Nach dem Krieg vollzog sich das, woran alle weitsichtigen Politiker, Ökonomen und Wissenschaftler hofften, nämlich eine Einigung aller deutscher Staaten zu einem einheitlichen Gebilde. Mit dem Jahr 1871 wurde das Deutsche Kaiserreich proklamiert. Das Deutsche Reich war nun fast an seiner wirtschaftlichen Blüte angekommen. Die Industrie brummte und produzierte die entsprechenden Mengen an Gütern. Dennoch blieben die Eisenbahnen sehr zum Leidwesen des Reichskanzlers Bismarck in den Händen der einzelnen Staatsouveräne. In knapp 40 Jahren war Deutschland zum zweitmächtigsten Staatswesen in Europa aufgeblüht. Nur noch das britische Empire war mächtiger als das Kaiserreich. Hierin lag aber auch die Gefahr. Der nationalistische Gedanke nahm Überhand und führte dazu, dass sich Deutschland aufgrund seiner Wirtschaftskraft als Führungskraft in Europa sah. Das übersteigerte Nationalbewusstsein führte letztendlich mit dem Ausbruch des 1. Weltkriegs in die große europäische Katastrophe. So wie die Industrialisierung alle Bereiche des zivilen Lebens durchdrungen hatte, so zeigte sie jetzt auch ihr Gesicht in unendlichen Materialschlachten, dem Verlust vieler Menschenleben und einer vollkommenen Entmenschlichung der Kriegführung. Den Transport zu den Kriegsschauplätzen übernahm nach wie vor die Bahn. Da mittlerweile jedoch alle europäischen Länder die militärstrategische Bedeutung des logistischen Transports auf der Schiene erkannt hatten, konnte sich kein Land mehr einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Der Krieg führte im Laufe der Zeit zu Verlust und Verschleiß auf allen Seiten. Das Deutsche Reich ging als großer Verlierer aus der Schlacht hervor. Das während des Krieges völlig auf die militärischen Belange ausgerichtete Eisenbahnwesen lag im Jahr 1918 völlig darnieder. Darüber hinaus musste Deutschland erhebliche Reparationsleistungen an die Siegermächte leisten. Hierzu zählten vor allem Kohlelieferungen als auch das Abgeben der technisch hochwertigsten Transportmittel, wie z.B. moderne Schiffe, Dampflokomotiven, Reise- und Güterzugwagen und dergleichen.
Bilder, Marken und Logos sind Eigentum der jeweils genannten Hersteller