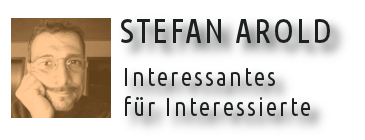Lebensstil & Design - Nierentischromantik
Die besagte Party war ein Trend, der aus den Vereinigten Staaten kam. Viele dieser Modeerscheinungen die über den großen Teich kamen, sind kaum hinterfragt worden. Statt dessen wurden viele Dinge aus den USA in Deutschland geradzu begierig von der Bevölkerung aufgenommen. Es konnte ja schließlich nicht schlecht sein, was aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten zu uns schwappte. Egal ob es sich dabei um die Party, die Coca Cola oder der Rock 'n' Roll handelte. Na ja, letztgenanntes gehörte dann doch in konservativen Kreisen zusammen mit seinen Auswüchsen in die Sparte "Negermusik", "Halbwilde und Halbstarke". Doch die Party, bzw. die Steh-Party, galt als Indiz für eine kultivierte und damit gute Errungenschaft aus den USA.
 Deutschland hatte nach 1945 und den
entbehrungsreichen Nachkriegsjahren einen großen Nachholbedarf, was
den
Spaß am Leben anbetraf. Die Maxime lautete: "Heiterkeit statt
Verbissenheit" und "Leben statt Darben". Langsam kehrte in
Deutschland ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein zurück. Nach der
Währungsreform füllten sich die Regale urplötzlich wieder und
die bis dahin vorhandene Agonie wich vielerorts der Lebensfreude. Die
Party half dabei und
mit ihr etablierte sich zeitgleich eine ganze Industrie, die
für die nötigen Accessoires wie Zigarettenspender,
Aschenbecher, Salzstangenmännchen, Serviettenhalter oder
Cocktailgläser sorgte, so dass die jetzt "Party" genannte Feier
auch stilgerecht ausgestattet werden konnte. Dabei musste natürlich
von der
Einladungskarte über den obligatorischen "Käse-Igel"
und anderen Häppchen des Buffet alles entsprechend
ausgerichtet sein.
Deutschland hatte nach 1945 und den
entbehrungsreichen Nachkriegsjahren einen großen Nachholbedarf, was
den
Spaß am Leben anbetraf. Die Maxime lautete: "Heiterkeit statt
Verbissenheit" und "Leben statt Darben". Langsam kehrte in
Deutschland ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein zurück. Nach der
Währungsreform füllten sich die Regale urplötzlich wieder und
die bis dahin vorhandene Agonie wich vielerorts der Lebensfreude. Die
Party half dabei und
mit ihr etablierte sich zeitgleich eine ganze Industrie, die
für die nötigen Accessoires wie Zigarettenspender,
Aschenbecher, Salzstangenmännchen, Serviettenhalter oder
Cocktailgläser sorgte, so dass die jetzt "Party" genannte Feier
auch stilgerecht ausgestattet werden konnte. Dabei musste natürlich
von der
Einladungskarte über den obligatorischen "Käse-Igel"
und anderen Häppchen des Buffet alles entsprechend
ausgerichtet sein.
Deutschland befand sich inmitten der Fünfziger Jahre in einer Umbruchphase. Einerseits wollte man alt hergebrachte Traditionen bewahren, andererseits sich aber auch den Segnungen der neuen Zeit nicht ganz verschließen und so vermischten sich hier auf merkwürdige Weise alte und neue Stilelemente zu einem eigenartigen Mix des Lebensgefühls.
Besonders auffällig wird der Ausdruck eines neuen Stils am Mobiliar der 50er Jahre. Kräftige, teilweise auch pastellene Farben, schlanke Formen, glatte Oberflächen und runde Dreiecksformen (der so genannte Nierentisch) sowie asymetrisch gehaltene Trapezoberflächen mit Intarsien prägten diese Zeit, zumindest in der begüterten und modernen Bevölkerungsschicht. Die überwiegend Mehrheit war jedoch nach wie vor bürgerlich-konservativ eingestellt, hatte in der Wohnstube das "barocke" Sofa und den schweren Eichenschrank stehen und vielleicht als zusätzliches Element eine moderne Stehlampe. Die Freizügigkeit in der Gestaltung der Zimmer setzte sich nur sehr langsam durch. Besonders herausragend für den 50er Jahre-Stil war eine klare funktionale Linie. Diese Funktionalität wurde über die Ästhetik des Gegenstands gestellt. Dabei gaben Designer aus Italien, Skandinavien und den USA die Richtung vor. Stilistische Anleihen an der Neuen Sachlichkeit und Stromlinienform der 30er Jahre sowie am italienischen Funktionalismus sind unverkennbar. Wer es sich leisten konnte richtete seine Wohnräume mit viel Platz und sehr hell ein. Flach gewirkte Teppiche an den Wänden und den Fußböden zierten die Zimmer und schlanke Leuchter mit kegelförmigen Lampenschirmen schmückten die Decken oder standen als Stehleuchten in den Zimmern. Cocktailsessel, filigrane Sofas und Sideboards oder Stahlrohrmöbel komplettierten die Räume. Darüber hinaus durften im Wohnzimmer eine Phono- und Musiktruhe - teils sogar mit Tonbandgerät und Fernseher ausgestattet - nicht fehlen. Das Wohnzimmer diente dabei nicht mehr nur dem Zweck, dass sich das gesamte familiäre Leben in ihm abspielte, sondern es war das Zimmer der Entspannung, der kurzweiligen Unterhaltung und der heimischen Repräsentanz.Die Hausfrau konnte sich ihre Arbeit in vielen Fällen
mit
unterstützenden Haushaltsgeräten erleichtern. Der
Mixer oder Toaster, das elektrische Bügeleisen, die
Nähmaschine sowie Waschmaschine und Staubsauger waren
begehrte Geräte, die in Form und Farbgebung von den Designern
dem allgemeinen Zeitgeschmack angepasst wurden. Auch hier ist
unverkennbar, dass es gerade die Funktionsweise war, der sich die
Stilgebung unterzuordnen hatte.
Die Formgebung der Fünfziger Jahre ist natürlich auch in der Architektur weitergeführt worden. Viele öffentliche Bauten dieser Zeit trugen Form und Funktionalität genauso nach außen wie sie sich in den bürgerlichen Haushalten offenbarten. Oftmals sind diese Gebäude bereits abgerissen, da der Zahn der Zeit an den meist schnell errichteten Bauwerken stark nagte und eine Unterhaltung oft unangemessen gewesen wäre. Wo dies nicht der Fall war konnte es in späteren Jahrzehnten leicht zu einer Katastrophe kommen, wie dies der Einsturz der Kongreß-Halle - auch "Schwangere Auster" genannt - in Berlin bewies. Die Kongreß-Halle ist jedoch architektonisch so beeindruckend, dass sich der Senat entschloß, das Gebäude wieder zu errichten.
Zum Lebensstil dieser Zeit gehörten natürlich auch die "Lichtspielhäuser" sowie die "Milchbars". Beide waren beliebte Treffpunkte für die Jugend. Vor allem die Milchbar entsprach in ihrer Aufmachung den Cocktailbars. Das Ziel solcher Bars war es, den heimischen Absatz von Molkereiprodukten zu stärken. Aus diesem Grunde wurden überwiegend Speiseeis- und Milchprodukte serviert. Zur Einrichtung einer Milchbar gehörten neben einem langen Tresen auch leichte Tische und Stühle und natürlich eine zeitgemäße Musikbox, aus der die neuesten Schlager oder Rock 'n' Roll Titel ertönten. Dadurch entwickelte sich die Milchbar zu einem beliebten Treffpunkt der Jugendlichen, die hier ungestörte Kontakte zu Ihresgleichen knüpfen und sich somit der Kontrolle der Eltern in begrenztem Maße entziehen konnten. Vergegenwärtigt man sich, dass das Zusammenleben meist mehrerer Generationen auf engem Raum und in beengten Wohnverhältnissen nach wie vor die Regel darstellte, weiß man auch, warum dies für die junge Generation so wichtig war. Deshalb gehörte auch der Besuch des Rummelplatzes, auf dem man sich mit Gleichaltrigen und Gleichgesinnten traf, zu einer beliebten Freizeitbeschäftigung.
Darüber hinaus begann sich die junge Generation von ihren Eltern abzugrenzen. Dazu bildete sich eine eigene Subkultur aus. Vor allem die aus der Arbeiterschicht stammenden Jugendlichen suchten den offenen Konflikt mit der älteren Generation. Diese Erscheinung hatte ihren Ursprung ebenfalls in den Vereinigten Staaten. Einen persönlichen Ausdruck des Rebellentums verliehen die Jugendlichen ihrem Auftreten durch einen eigenen Modegeschmack. Die Jungens trugen Röhrenhosen (Jeans) und Lederjacken, kämmten die Haare zurück wie Elvis Presley, die Mädchen kleideten sich in den Pettycoat und trugen die Haare zu einem Pferdeschwanz. Verstärkt wurde das adaptierte Erscheinungsbild durch Filmstars wie James Dean und Marlon Brando. Man traf sich auf offener Straße, lärmte mit seinen Zweirädern und forderte im harmloseren Fall die Autorität der Gesellschaft heraus. In besonderen Auswüchsen entlud sich der Gegensatz in offener Gewalt, wie dies z.B. die Zerstörung ganzer Konzertsäle nach Auftritten von Bill Haley in Deutschland 1956 deutlich wurde. Abschätzig sprachen die Älteren von einer Jugendverwahrlosung der "Halbstarken". Natürlich war auch hier die Ursache schnell gefunden und zwar nicht durch Mängel im eigenen Land oder der Erziehung, sondern durch fremdartige Kultureinflüsse. Hier lag weder ein pädagogisches noch ein wissenschaftliches Konzept zugrunde und dem Phänomen wurde lediglich mit gefährlicher Polemik begegnet. Doch auch das konnte die neue Jugendkultur nicht aufhalten.
Die Mode der 50er Jahre
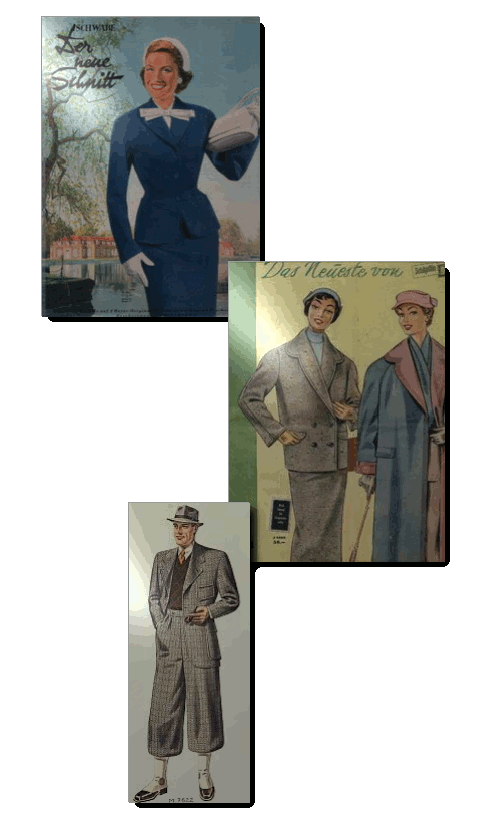 Die
Mode der 50er Jahre war ausgesprochen konservativ obgleich man sich am
französischen oder italienischen Modeideal zu orientieren versuchte. Die
Männer bevorzugten es nach wie
vor klassisch. Der Anzug mit einem schmalen Binder und einem
weißen Hemd war ein Muss. Ordentliche Bekleidung war damals
nicht
nur ein gesellschaftlicher Zwang, sondern verdeutlichte auch nach
außen den Status seines Trägers. Individuelle
Freizeitbekleidung sah man in der Öffentlichkeit sehr selten.
Der
Mann von Welt trug einen Anzug oder eine Kombination. Die Hosen waren
relativ weit
geschnitten. Die Röhrenform war verpönt und wurde nur
im
Zusammenhang mit den Halbstarken gesehen. Wer etwas auf sich hielt,
trug auch die passende Kopfbedeckung. Herr wie Frau waren buchstäblich
gut
behütet. In
konservativen Kreisen noch immer beliebt, war die aus
den 30er Jahren stammende Knickerbocker. Als Wahlspruch
galt: "Und sitzt die
Sch..... noch so locker, sicher hält's die
Knickerbocker".
Gleichwohl stand sie aber nicht mehr für den modischen
Zeitgeist
der 50er Jahre. Bei Freizeit und Sport durfte es gerne auch etwas
legerer zugehen. Ein Hemd mit Pullunder und eine Bundfaltenhose waren
ebenfalls gestattet. Alles in allem wollte man sich durch ordentliche
Kleidung von der alltäglichen Arbeit abheben.
Die
Mode der 50er Jahre war ausgesprochen konservativ obgleich man sich am
französischen oder italienischen Modeideal zu orientieren versuchte. Die
Männer bevorzugten es nach wie
vor klassisch. Der Anzug mit einem schmalen Binder und einem
weißen Hemd war ein Muss. Ordentliche Bekleidung war damals
nicht
nur ein gesellschaftlicher Zwang, sondern verdeutlichte auch nach
außen den Status seines Trägers. Individuelle
Freizeitbekleidung sah man in der Öffentlichkeit sehr selten.
Der
Mann von Welt trug einen Anzug oder eine Kombination. Die Hosen waren
relativ weit
geschnitten. Die Röhrenform war verpönt und wurde nur
im
Zusammenhang mit den Halbstarken gesehen. Wer etwas auf sich hielt,
trug auch die passende Kopfbedeckung. Herr wie Frau waren buchstäblich
gut
behütet. In
konservativen Kreisen noch immer beliebt, war die aus
den 30er Jahren stammende Knickerbocker. Als Wahlspruch
galt: "Und sitzt die
Sch..... noch so locker, sicher hält's die
Knickerbocker".
Gleichwohl stand sie aber nicht mehr für den modischen
Zeitgeist
der 50er Jahre. Bei Freizeit und Sport durfte es gerne auch etwas
legerer zugehen. Ein Hemd mit Pullunder und eine Bundfaltenhose waren
ebenfalls gestattet. Alles in allem wollte man sich durch ordentliche
Kleidung von der alltäglichen Arbeit abheben.
Die Damenwelt richtete sich in ihren modischen Geschmacksfragen insbesondere nach dem französischen Modeschöpfer Christian Dior und seinen alljährlichen Kollektionen. Sie bestimmten weite Strecken der 50er Jahre. Das modische Ideal der Frau konnte nahezu jeder gängigen Mode-Illustrierten entnommen werden. Das klassische Kostüm, figurbetont mit einem engen Rock galt als Standard. Im Sommer trugen die Frauen luftige Sommerkleider nach italienischen Schnittmustern. Der Pettycoat war etwas für die Jugend. Hosen trugen Frauen lediglich zum Sport oder in ihrer Freizeit. Hier insbesondere die so genannte "Capri Hose". Wichtiges und zugleich begehrtes Kleidungsstück für Frauen waren die teuren Nylon-Strümpfe. Es gab viele Tipps und Tricks, wie sich Laufmaschen vermeiden oder beheben ließen. Auch die Frau trug eine Hut, der entsprechend auf die Bekleidung abgestimmt war. Handtaschen in edler Lederausführung gehörten ebenfalls zu einer gut gekleideten Dame. Krokodilleder galt dabei als besonders exquisit.
Es lässt sich sehr gut erkennen, dass die Fünfziger Jahre ihr eigenes Design und ihren eigenen Lebensstil hervorgebracht haben, auch wenn sich dieser stark im Spannungsfeld zwischen bröckelnder Tradition und Aufbruch in eine neue Zeit bewegte.
Die Bilder, Marken und Logos sind Eigentum der jeweils genannten Hersteller