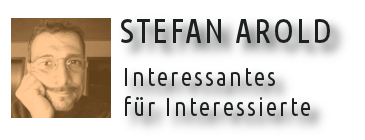Mobilität - Wenn einer eine Reise tut...
In
den Fünfziger Jahren schätzten die Deutschen italienische Schlager
ebenso
wie den deutschen Heimatfilm. Italienische Künstler wie Vico
Torriani, Caterina Valente oder Domenico Modugno waren gefragte
Künstler. Sangen sie doch von ihrer Heimat, der Sonne und dem
warmen Süden und verstärkten zugleich den heimlichen
Wunsch,
auch einmal den Urlaub in der
Fremde zu verbringen oder
ferne Ziele zu besuchen. Endlich mal der heimischen
Tristesse - die Kriegsschäden waren noch deutlich zu sehen -
zu
entfliehen, das war für viele Bundesbürger das gesetzte Ziel. Alleine
der Weg
war
beschwerlich, vor allem
dann, wenn es an einem fahrbaren Untersatz fehlte.
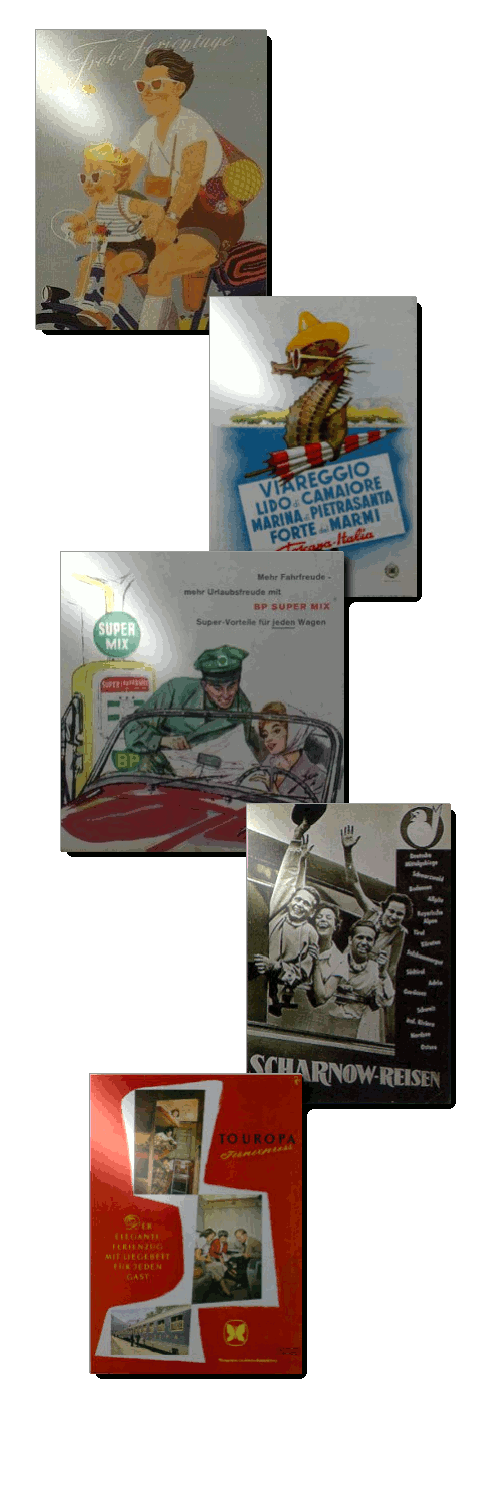 Deutschland
hatte
nach dem Krieg viel
Nachholbedarf und mit dem stetig wachsenden Wohlstand wuchs das
Verlangen nach Unabhängigkeit. Mit Hilfe eines Zweirads oder Autos
wollte man seine
Leistungsfähigkeit nicht nur optisch zum Ausdruck bringen.
Wollte man sich auch unabhängig bewegen, so war dies die Voraussetzung
dafür neue Länder und Menschen kennenlernen zu können. Nur so ließen
sich die ersehnten Orte auf
individuelle Art und Weise erkunden. Wer sich das nicht leisten
konnte, versuchte seinen Urlaubsort zumindest mit der Bahn oder dem Bus
zu erreichen.
Deutschland
hatte
nach dem Krieg viel
Nachholbedarf und mit dem stetig wachsenden Wohlstand wuchs das
Verlangen nach Unabhängigkeit. Mit Hilfe eines Zweirads oder Autos
wollte man seine
Leistungsfähigkeit nicht nur optisch zum Ausdruck bringen.
Wollte man sich auch unabhängig bewegen, so war dies die Voraussetzung
dafür neue Länder und Menschen kennenlernen zu können. Nur so ließen
sich die ersehnten Orte auf
individuelle Art und Weise erkunden. Wer sich das nicht leisten
konnte, versuchte seinen Urlaubsort zumindest mit der Bahn oder dem Bus
zu erreichen.
Aufgrund alliierter Bestimmungen gab es für den Individualverkehr zunächst viele Restriktionen und Produktionsbeschränkungen. Und außerdem ging es den Deutschen zunächst darum, die Existenz mit dem Wichtigsten zum Überleben zu sichern. Erst als die Wirtschaft nach und nach wuchs, entwickelte sich auch ein bescheidener Wohlstand. Ein eigenes Auto war von je her ein teures Luxusgut. Alleine ein VW-Käfer, grundsätzlich als Auto für die breite Masse konzipiert, kostete in der Einstiegsvariante rund 3.500 DM. Bei einem Durchschnittsverdienst von ca. 300,- DM monatlich musste Otto-Normalverbraucher inmitten der fünfziger Jahre ganz schön tief in die Tasche greifen um sich ein derartiges Luxusgut leisten zu können.
Aber es gab Alternativen: Das Zweirad, und hier vornehmlich der Roller, boten einen preiswerten Ersatz, um sich mit einem fahrbaren Untersatz auszustatten. Darüber hinaus gab es in Deutschland eine Reihe von Kleinfahrzeug-Produzenten, die z.B. der ehemaligen Flugzeugproduktion entstammten und aufgrund des Verbots Flugzeuge herzustellen, nach einem neuen Absatzgebiet suchten. Sie fanden dies in der Fertigung von Kleinfahrzeugen.
"Menschen in Aspik" waren glücklich über ihren "Schneewittchensarg", auch wenn sie sich manchmal etwas unbequem in ihren Kabinenroller zwängen mussten oder mit ihrer "Knutschkugel" oder dem "Goggo" auf große Reise gingen. Bei Anschaffungskosten, die in etwa nur die Hälfte eines normalen Autos betrugen, war zumindest die gewünschte Mobilität gewährleistet.
Richtige Autos allerdings, wie ein Opel "Kapitän", ein Borgward "Isabella", ein DKW 3=6 oder gar ein Mercedes "SL" waren nach wie vor auf Deutschlands Straßen die große Ausnahme und nur für einen begüterten Personenkreis erschwinglich. Wo immer solch ein Fahrzeug auftauchte, wurde es bestaunt. An den Tankstellen wurde damals Service noch groß geschrieben. Der Tankwart, half beim Tanken, reinigte die Scheiben oder stand anderweitig mit Rat und Tat zur Seite. Der Großteil der Fahrzeuge benötigte noch ein Zweitakt-Gemisch 1:25. In den Städten regelte der Schutzmann auf der Straße den Verkehr. Ampeln gab es relativ wenige. Und dort, wo das Verkehrsaufkommen noch relativ gering war, da lief der Schutzmann durch die Ortschaft oder fuhr mit dem Fahrrad. Obwohl die meisten Straßen nach heutigen Maßstäben geradzu leer waren, gab es mehr Verkehrsunfälle und Verkehrstote, denn günstige Mobilität erkaufte man sich damals auch über eine geringere Verkehrssicherheit. Trotzdem nahm die Motorisierung der Massen in den 50er Jahren beständig zu. Die Entwicklung des Individualverkehrs war nicht mehr aufzuhalten.
Mit deren Folgen muss vor allem die heutige Generation zurecht kommen.
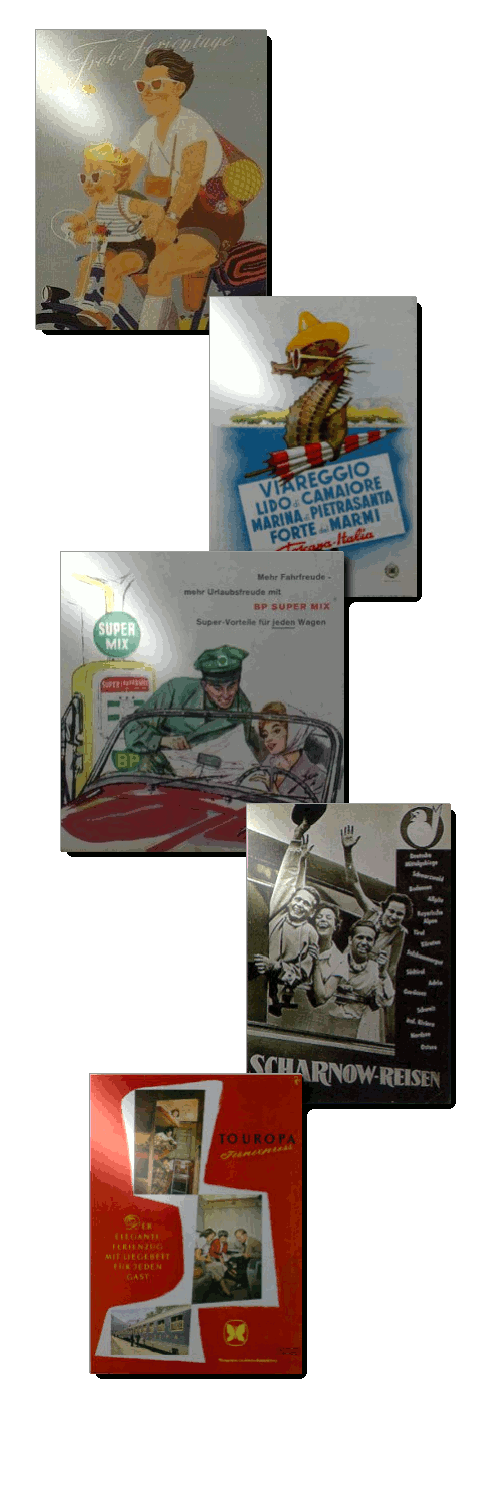 Deutschland
hatte
nach dem Krieg viel
Nachholbedarf und mit dem stetig wachsenden Wohlstand wuchs das
Verlangen nach Unabhängigkeit. Mit Hilfe eines Zweirads oder Autos
wollte man seine
Leistungsfähigkeit nicht nur optisch zum Ausdruck bringen.
Wollte man sich auch unabhängig bewegen, so war dies die Voraussetzung
dafür neue Länder und Menschen kennenlernen zu können. Nur so ließen
sich die ersehnten Orte auf
individuelle Art und Weise erkunden. Wer sich das nicht leisten
konnte, versuchte seinen Urlaubsort zumindest mit der Bahn oder dem Bus
zu erreichen.
Deutschland
hatte
nach dem Krieg viel
Nachholbedarf und mit dem stetig wachsenden Wohlstand wuchs das
Verlangen nach Unabhängigkeit. Mit Hilfe eines Zweirads oder Autos
wollte man seine
Leistungsfähigkeit nicht nur optisch zum Ausdruck bringen.
Wollte man sich auch unabhängig bewegen, so war dies die Voraussetzung
dafür neue Länder und Menschen kennenlernen zu können. Nur so ließen
sich die ersehnten Orte auf
individuelle Art und Weise erkunden. Wer sich das nicht leisten
konnte, versuchte seinen Urlaubsort zumindest mit der Bahn oder dem Bus
zu erreichen.Aufgrund alliierter Bestimmungen gab es für den Individualverkehr zunächst viele Restriktionen und Produktionsbeschränkungen. Und außerdem ging es den Deutschen zunächst darum, die Existenz mit dem Wichtigsten zum Überleben zu sichern. Erst als die Wirtschaft nach und nach wuchs, entwickelte sich auch ein bescheidener Wohlstand. Ein eigenes Auto war von je her ein teures Luxusgut. Alleine ein VW-Käfer, grundsätzlich als Auto für die breite Masse konzipiert, kostete in der Einstiegsvariante rund 3.500 DM. Bei einem Durchschnittsverdienst von ca. 300,- DM monatlich musste Otto-Normalverbraucher inmitten der fünfziger Jahre ganz schön tief in die Tasche greifen um sich ein derartiges Luxusgut leisten zu können.
Aber es gab Alternativen: Das Zweirad, und hier vornehmlich der Roller, boten einen preiswerten Ersatz, um sich mit einem fahrbaren Untersatz auszustatten. Darüber hinaus gab es in Deutschland eine Reihe von Kleinfahrzeug-Produzenten, die z.B. der ehemaligen Flugzeugproduktion entstammten und aufgrund des Verbots Flugzeuge herzustellen, nach einem neuen Absatzgebiet suchten. Sie fanden dies in der Fertigung von Kleinfahrzeugen.
"Menschen in Aspik" waren glücklich über ihren "Schneewittchensarg", auch wenn sie sich manchmal etwas unbequem in ihren Kabinenroller zwängen mussten oder mit ihrer "Knutschkugel" oder dem "Goggo" auf große Reise gingen. Bei Anschaffungskosten, die in etwa nur die Hälfte eines normalen Autos betrugen, war zumindest die gewünschte Mobilität gewährleistet.
Richtige Autos allerdings, wie ein Opel "Kapitän", ein Borgward "Isabella", ein DKW 3=6 oder gar ein Mercedes "SL" waren nach wie vor auf Deutschlands Straßen die große Ausnahme und nur für einen begüterten Personenkreis erschwinglich. Wo immer solch ein Fahrzeug auftauchte, wurde es bestaunt. An den Tankstellen wurde damals Service noch groß geschrieben. Der Tankwart, half beim Tanken, reinigte die Scheiben oder stand anderweitig mit Rat und Tat zur Seite. Der Großteil der Fahrzeuge benötigte noch ein Zweitakt-Gemisch 1:25. In den Städten regelte der Schutzmann auf der Straße den Verkehr. Ampeln gab es relativ wenige. Und dort, wo das Verkehrsaufkommen noch relativ gering war, da lief der Schutzmann durch die Ortschaft oder fuhr mit dem Fahrrad. Obwohl die meisten Straßen nach heutigen Maßstäben geradzu leer waren, gab es mehr Verkehrsunfälle und Verkehrstote, denn günstige Mobilität erkaufte man sich damals auch über eine geringere Verkehrssicherheit. Trotzdem nahm die Motorisierung der Massen in den 50er Jahren beständig zu. Die Entwicklung des Individualverkehrs war nicht mehr aufzuhalten.
Mit deren Folgen muss vor allem die heutige Generation zurecht kommen.
Die
Bilder, Marken und Logos sind Eigentum der jeweils genannten
Hersteller